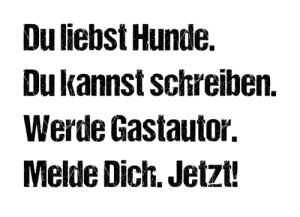Pünktlich zum Start von „Das Tier und wir“ von Christina Hucklenbroich eine Leseprobe vom ersten Kapitel „Eine Beziehung im Wandel“.
Ein Blick auf den Status quo: Wer hält Tiere, wie und warum?
Die Nähe zwischen Menschen und Tieren wächst. Wir skypen mit Hunden, Katzen dürfen mit ins Bett.
Aber es gibt auch Tiere, von denen die Menschen Abstand nehmen: Man hat heute keine Wellensittiche mehr, weil ihre Käfige den Menschen wie Gefängnisse erscheinen.
Wenn der erste Bus die Kreuzung im Zentrum um 6:28 Uhr ansteuert, schläft das Dorf noch. Niemand steigt zu. Erst in
der Nähe der Bauernhöfe ringsum werden ein paar Azubis an den Haltestellen warten, erzählt die Busfahrerin. Sie werden an einem abgelegenen Bahnhof zehn Kilometer weiter wieder aussteigen, von dort fährt ein Regionalzug in die nächste Großstadt. Um kurz vor sieben geht im Kindergarten das Licht an, um halb acht im einzigen Geschäft des Dorfes, einem Tante-Emma-Laden, der von Brötchen bis zur Barbiepuppe alles verkauft. Und dann kehrt schnell Leben ein. Die Schulkinder bilden Trauben an der Bushaltestelle. Die Mütter kehren mit leeren Buggys vom Kindergarten zurück. Ein einsamer Jogger und drei Hundehalter sind unterwegs in Richtung Wald. Die Sonne geht erst um halb neun auf, jetzt im Januar. Dann fahren auch die Autos aus den Garagen neben den Einfamilienhäusern und nehmen Kurs auf die Landstraße.
Das Dorf liegt im Speckgürtel einer Großstadt, viele Familien mit Kindern sind in den vergangenen Jahren hierhergezogen, haben riesige Trampolins in den Gärten aufgestellt und für bessere Busverbindungen gekämpft. Und sie haben sich Haustiere angeschafft, vor allem Hunde und Katzen. Das sagt Karin*, die in einem schicken Einfamilienhaus in der Dorfmitte lebt. »Inzwischen hat jeder im Ort ein oder zwei Tiere«, sagt sie. »Das war vor zwanzig oder dreißig Jahren überhaupt nicht so. Es sind die Zugezogenen, die heute so viele Tiere halten. Ich habe fast das Gefühl, die Leute ziehen hierher, weil sie mit dem Hund schnell im Wald sein können. Weil sie hier so gut ein Leben mit Hund führen können.« Karin ist selbst einmal Zugezogene gewesen, sie hat 1970 in das Dorf eingeheiratet, das zu dem Zeitpunkt gerade mal 300 Einwohner hatte. »Damals hatte kaum jemand Hunde und Katzen«, sagt Karin. Viele der Alteingesessenen hielten ein paar Nutztiere in den Gärten, Hühner oder Schafe waren keine Seltenheit. Karin und ihr Mann legten sich einige Jahre nach der Hochzeit den ersten Hund zu, einen Cockerspaniel. »Wenn man mit dem Hund im Wald spazieren ging, dann war man damals wirklich allein«, sagt Karin. Das war noch bis weit in die Achtzigerjahre so. Dann entstanden mehrere große Baugebiete für Einfamilienhäuser. Und mit den Neubürgern kamen die Hunde. Die Gemeindeverwaltung im nächstgrößeren Nachbarort bestätigt diesen Trend. Hier werden die Daten von mehreren kleinen Orten gesammelt, die insgesamt etwa 10.000 Einwohner haben. Mehr als tausend davon zahlen Hundesteuer. »Tendenz steigend«, sagt die Dame im Rathaus. Wenn man an diesem Morgen den Wald, der das Dorf von allen Seiten umgibt, einmal durchquert, trifft man fünf Hunde: Zwei Beagle, einen Weimaraner, einen Mops, einen Border Collie. Und den großen schwarzen Mischling Paul. Anja, seine Besitzerin, kennt und duzt alle anderen Hundebesitzer, die ihr begegnen. Sie geht diese Tour seit Jahren jeden Morgen. Ihr Tempo ist zügig, für die große Runde braucht sie dreißig Minuten, dann ist sie wieder an ihrer Haustür angelangt.
Im Vorgarten schmelzen Schneereste, im Küchenfenster steht noch Weihnachtsdekoration. »Ich bin froh, wenn der Weihnachtsbaum wieder abgebaut ist«, sagt Anja drinnen, an ihrem Esstisch im Wohnzimmer. »Ich würde auch nie ein Bügelbrett ins Wohnzimmer stellen.« Paul liegt ein paar Schritte entfernt und schaut sehnsüchtig durch die Terrassentür in den Garten. Dem mit lila und rosafarbenen Kugeln geschmückten Weihnachtsbaum schenkt er keinen Blick. Die Ruhe könne täuschen, sagt Anja.
»Wenn er einen Anfall hat, ist er danach erst mal so neben der Spur, dass er auch Blumentöpfe runterreißt.«
Paul ist sechs Jahre alt.
Fünf davon leben Anja, ihr Mann und die beiden Kinder mit seinen epileptischen Anfällen, unter denen er leidet, seitdem er dem Welpenalter entwachsen ist. Anja hatte sich den Hund zugelegt, als sie gerade in das Dorf gezogen war, denn sie fand, dass sich das große Haus mit Garten und der nahe Wald perfekt für ein Leben mit Hund eigneten. Das erste Jahr verlief auch genau so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Dann kam der erste Anfall. »Kopf und Kiefer krampfen, er hat starke Zuckungen an allen Gliedmaßen«, beschreibt Anja die Situationen. »Anfangs hat er auch Urin und Kot dabei verloren. Das Ganze dauert bis zu sechs, sieben Minuten. Je länger, desto größer die Ausfälle danach. Er ist teilweise einige Minuten blind, kommt nicht auf die Beine, ist sehr unruhig, läuft gegen die Wand und bellt uns an.« Beim ersten Anfall rief Anja sofort den Tierarzt, der seitdem verschiedene Medikamente ausprobiert hat. Anfallsfrei ist Paul nie wieder geworden. »Im Moment bekommt er sieben verschiedene Tabletten am Tag«, sagt Anja. »Man darf eigentlich gar nicht so genau ausrechnen, wie viel das kostet.« Anja sorgt dafür, dass er die Tabletten morgens und abends stets zu immer denselben Uhrzeiten bekommt, immer um genau sieben Uhr. »Ich bin da natürlich auch perfektionistisch «, sagt sie. Ihr Mann wendet manchmal ein: »Wir können nicht unser ganzes Leben nach dem Hund richten.« Er hole sie zurück auf den Teppich, sagt Anja. »Das ist wichtig, weil ich sonst, glaube ich, vielleicht den Punkt verpassen würde, an dem man zurückschalten muss, wenn da nicht jemand wäre, der sagt: Wir müssen auch mal in den Urlaub fahren. Ich hab ja schon ein Problem, wenn wir mal um sieben ins Kino wollen. Auch die Kinder merken, dass wir nicht so flexibel sind.«
Anja schläft unruhig, weil sie darauf horcht, ob Paul einen nächtlichen Anfall hat. Sie ist ungern länger als drei, vier Stunden außer Haus, weil sie befürchtet, dass der Hund in ihrer Abwesenheit das Bewusstsein verliert und danach orientierungslos durch die Zimmer irrt. Ein Jahr lang ist die Familie überhaupt nicht gemeinsam in den Urlaub gefahren, weil Pauls Anfälle sich häuften. Seit einem halben Jahr arbeitet Anja wieder als Grundschullehrerin, nach mehreren Jahren Pause, als die Kinder klein waren. »Es ist nur eine halbe Stelle, aber ich muss trotzdem häufig die Rektorin um bestimmte Arbeitszeiten bitten, damit ich nicht zu lange am Stück von zu Hause weg bin – wegen meines kranken Hundes. Das ist schon ein komisches Gefühl. Ich frage mich auch, was Kollegen, die keinen Hund haben, darüber denken.« Anjas Kinder sind elf und dreizehn Jahre alt. »Die Kinder sind so groß, dass ich wegen ihnen nie um besondere Arbeitszeiten bitten muss. Neulich hatte mein Sohn Grippe. Er war eine ganze Woche zu Hause und ich musste keinen Tag freinehmen, er hat sich ganz allein versorgt, während wir arbeiteten. Eigentlich bin ich völlig flexibel, wenn nicht der Hund wäre. Alle meine Bitten an meinen Arbeitgeber beziehen sich auf den Hund.« Warum sie das alles macht? Anja hebt die Schultern. »Mein Mann sagt manchmal, da sei auch viel Egoismus dahinter. Man wird nicht wirklich von dem Hund geliebt, meint er.« Und was denkt Anja selbst? Sie ist mit einem Hund aufgewachsen, er starb, als sie dreizehn war. »Das war der Weltuntergang «, erinnert sie sich. Wenn sie heute mit Paul durch die Natur geht, schnellen Schrittes, dann ist sie sogar an eiskalten, ungemütlichen Januartagen wie heute fröhlich und aufgekratzt. Einschläfern lassen würde sie ihn wegen seiner Krankheit nie. Auch die Tierärzte sagen, dass es keinen Grund dafür gibt, weil seine Lebensqualität nicht eingeschränkt ist. Freunde und Bekannte haben ihr aber schon oft gesagt, dass sie mit einem solchen Hund nicht leben wollten. »Sie warnen mich: Pass auf, bei jedem Anfall gehen Gehirnzellen verloren. Es kann sein, dass er dich irgendwann nicht mehr erkennt«, sagt sie. »Vor allem, wenn die Leute selbst kein Tier haben, können sie all das, was ich in Kauf nehme, wohl nicht nachvollziehen.« Wolfgang würde es wahrscheinlich verstehen. Mit seiner Frau Barbara lebt er in Anjas Nachbarschaft. Wolfgang und Barbara sind kurz vor dem Rentenalter. Vor mehr als zwanzig Jahren ist ihre Katze gestorben. Seitdem haben sie kein Haustier mehr gehabt. An der Pinnwand im Flur steckt noch ein altes Foto von Wolfgang mit der Katze. Er trägt einen Strickpulli, Schlaghosen, steht vor einem Mietshaus. Die Katze auf seinem Arm ist noch ein Baby, sie stemmt die Vorderpfoten gegen seine Brust, er hält sie mit beiden Händen. »Das war 1975«, sagt Wolfgang. »Damals lebten wir noch in der Stadt. Im ersten Jahr haben wir die Katze mit einer Leine in der Umgebung ausgeführt, damit sie die Straßen kennenlernt und zurück nach Hause findet.«
Eigentlich war es Barbara gewesen, die eine Katze hatte haben wollen. Die beiden studierten damals, die Katze eines Kommilitonen hatte Junge bekommen und Barbara suchte sich eines aus. »Anfangs war Barbara ganz verrückt nach der Katze«, sagt Wolfgang. »Die Katze durfte in unserem Bett schlafen und wurde wie ein Baby verwöhnt. Aber schon nach zwei Jahren merkte ich, dass ihr Interesse nachließ. Ich weiß noch, dass ich Barbara darauf ansprach. Sie sagte: Ach, weißt du, jetzt ist sie schon zwei Jahre alt und hat noch immer kein Wort gesprochen.«
Aus der Küche ruft Barbara: »Das hast du damals gesagt. Hört sich genau nach deinem Humor an.«
Als die Katze drei Jahre alt war, bekam Barbara das erste Kind. »Von da an habe ich mich um die Katze gekümmert«, sagt Wolfgang. Er fütterte die Katze, brachte sie zum Tierarzt. Und er ließ sie jede Nacht gegen zwei Uhr wieder in die Wohnung, wenn sie erschöpft zurückkehrte von der Jagd in den umliegenden Gärten. Die Katze kratzte dann an der Terrassentür, Wolfgang wurde sofort wach, tappte ins Wohnzimmer und öffnete ihr. »Ich war daran eigentlich gewöhnt«, sagt er heute. »Es war fast so, dass ich beunruhigt war, wenn ich mal nicht geweckt wurde. Ich bin dann auch immer ganz schnell wieder eingeschlafen.«
Wolfgang hat sein Diplom gemacht, beruflich als Ingenieur Fuß gefasst und nebenher noch promoviert in diesen Jahren, in denen er keine Nacht durchschlief. Seine Kinder haben ihn das erste und einzige Mal weinen sehen an dem Tag im Sommer 1991, an dem die Katze eingeschläfert wurde. Sechzehn Jahre alt war sie geworden. Warum sie sich nie eine neue anschafften? Wolfgang und Barbara werfen sich einen Blick zu. »Wir waren eigentlich etwas abgetörnt damals«, sagt Wolfgang schließlich. »Am Ende hatte die Katze Diabetes. Ich musste ihr in den letzten zwei Jahren jeden Tag eine Insulinspritze geben, und das in einer Zeit, in der ich beruflich viel verreiste.« Barbara sagt, dass sie schon viel eher mit der Katzenhaltung abgeschlossen hatte. In einer Nacht Anfang der Achtzigerjahre, als ihr zweites Kind erst zwei Monate alt war, wurde sie plötzlich wach und sah nach dem Jungen, dessen Stubenwagen mit im Schlafzimmer stand. Auf der Decke, die über ihrem Sohn lag, mitten auf seinem Bauch, lag die Katze, die ungefähr genauso schwer war wie der Säugling. Dem Kind war nichts passiert. Trotzdem hätte sie es danach eigentlich besser gefunden, die Katze abzugeben, sagt Barbara. »Aber das hätte ich Wolfgang nicht antun können.«
Claudia hat noch länger ohne Haustiere gelebt als Wolfgang und Barbara. »Als Kind hatte ich ein Kaninchen«, erzählt sie in ihrer Küche in einem Haus am Dorfrand. »Aber vom zwölften Lebensjahr an hatte ich dann kein Haustier mehr.« Das ist dreißig Jahre her. Vor ein paar Jahren begannen Claudias Söhne dann, sich ein Haustier zu wünschen. »Das fing mit dem Grundschulalter an«, sagt Claudia. »Lange habe ich gesagt: Ihr müsst erst älter werden, damit ihr die Verantwortung übernehmen könnt. Und dass ich auch keine Lust habe, die ganze Arbeit zu machen.« Lange reichte das. Dann kam die Sache mit den fleischfressenden Pflanzen. Die Kinder waren inzwischen zehn und zwölf. »Sie haben recht dicht hintereinander Namenstag und hatten sich beide eine fleischfressende Pflanze gewünscht. Wir sind also losgefahren, aber in zwei verschiedenen Pflanzenmärkten hatten siekeine fleischfressenden Pflanzen. Nachdem wir aus dem zweiten Pflanzenmarkt kamen, machte sich im Auto allgemeine Frustration breit. Der Jüngere sagte: »Und wir dürfen nicht mal ein Tier haben.« Danach überlegten Claudia und ihr Mann noch eine Woche. »Dann rief ich beim Tierheim an und fragte nach Meerschweinchen.« Die beiden Meerschweinchen, die man ihnen verkaufte, leben inzwischen in der Plastikunterschale eines anderthalb Meter langen Käfigs im Zimmer des älteren Sohnes. »Das Gitter haben wir abgemacht, weil sie ohnehin nicht raus können«, erklärt Claudia.
Bisher haben die Kinder die Tiere immer abwechselnd in ihren Zimmern beherbergt. »Aber der Jüngere will sie jetzt schon nicht mehr zurück«, sagt Claudia.
»Wenn es nach ihm ginge, wären sie schon wieder im Tierheim. Ihm ist das zu viel Arbeit, man muss sie ja auch regelmäßig ausmisten.« Und Claudia, die sich so lange gegen Haustiere gewehrt hat? »Ich finde es eigentlich ganz gut«, sagt sie und lächelt etwas verlegen. »Es ist mir nicht lästig. Ich würde sie auch nicht wieder abgeben wollen. Der Hauptgrund dafür ist komischerweise, dass ich sicher bin, dass sie nirgendwo anders so gutes Futter bekommen würden wie bei uns.« Claudia pflückt im Sommer Gras und Kräuter und beschafft sogar Zweige von Obstbäumen zum Knabbern, im Winter kauft sie Grünfutter. Wenn sie das Zimmer betritt und den Meerschweinchen einen Arm Heu, Gurken oder Äpfel in den Käfig legt, hüpfen die Tiere vor Freude. »Ich liebe es, sie glücklich zu machen«, sagt Claudia. »Bei Freunden habe ich mal zufällig einen Blick in den Meerschweinchenkäfig werfen können. Da lagen drei Stück Möhren und ein paar Halme Heu. Bei uns haben die Meerschweinchen immer eine große Auswahl.«
Wie viele Meerschweinchen, Hamster, Kaninchen und Rennmäuse in den Einfamilienhäusern mit den gepflegten Vorgärten und den rauchenden Schornsteinen wohl leben?
Zahlen gibt es dazu nicht, anders als zu den Hunden. Es muss sie aber geben, die Katzen und die kleinen Heimtiere: Das Bürgerbüro hat im gerade vergangenen Jahr zwei Hunde, drei Wellensittiche, ein Kaninchen und vier Katzen registriert, die als Fundtiere aufgelesen worden waren. Ein solcher Streuner liegt in Karins Wohnzimmer unter dem Sofa. Von der Tür aus sieht man nur etwas in Grau- und Goldtönen Gestreiftes, das sich eingerollt hat. Im ersten Moment hat man den Eindruck, dass etwas ganz Wildes, Urtümliches in Karins gepflegtes Wohnzimmer mit dem camelfarbenen Ledersofa eingedrungen ist. Es könnte bei flüchtigem Hinsehen auch ein Python sein. In Wirklichkeit ist es nur die streunende Katze, die jeder im Ort kennt. Karin und ihr Mann Jürgen lassen sie im Winter jeden Morgen in ihre Küche, wo sie sich auf dem geheizten Natursteinboden sofort erleichtert ausstreckt, während die beiden frühstücken. Später am Tag legt sie sich meist unter das Sofa im Wohnzimmer. »Sie liegt da stundenlang und schläft«, sagt Karin. Abends schicken sie sie wieder vor die Tür. Sie füttern sie auch nicht, um sie nicht von ihnen abhängig zu machen, damit sie auch mal in Urlaub fahren können, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Karin weiß, dass verschiedene Familien im Ort der Katze Futter hinstellen.
Karin und Jürgen haben nach ihrem Cockerspaniel ein paar Jahre keinen Hund gehabt, danach einen Golden Retriever, der vor sieben Jahren gestorben ist. Im Moment überlegen sie immer wieder, ob sie wieder einen Hund haben möchten.
Sie haben sich sogar schon einen Wurf Golden-Retriever-Welpen bei einem Züchter in der Nähe angesehen. »Wir kommen nicht zum Zuge, weil wir uns nicht einigen können«, sagt Karin. »Ich hätte gern einen kleinen oder mittelgroßen Hund, Jürgen einen großen. Aber ich weiß noch, dass man unseren Golden Retriever, als er alt war, in den Kofferraum heben musste. Wir werden ja auch älter und wissen nicht, wie lange wir einen großen Hund noch heben können.«
Wohin wird sich die Tierhaltung entwickeln? Werden die Tiere mehr – so wie es die Gemeindeverwaltung des Dorfes erlebt, die die Hundesteuer-Statistik auswertet? Oder werden die Menschen zögerlicher, so wie Karin und Jürgen, Barbara und Wolfgang, die sich die Entscheidung für ein Haustier nicht leicht machen?
Und wenn ein Tier erst einmal da ist, wächst dann der individuelle Einsatz der Halter, wie man es annehmen könnte, wenn man die Geschichten der Menschen in dem kleinen Dorf hört, die ihre Tiere jahrelang für viel Geld behandeln lassen, wenn sie chronisch krank sind?
An einem Ort mehrere hundert Kilometer von diesem Dorf entfernt hat man auch noch keine abschließenden Antworten auf alles. Aber hier wird immerhin systematisch verfolgt, wie sich die Lebensbedingungen von Haustieren und die Interessen, die Sehnsüchte und das Konsumverhalten ihrer Halter verändern. Es ist ein glühend heißer Tag, aber in der Eingangshalle der elfenbeinfarbenen Villa nahe des Wiesbadener Hauptbahnhofs ist es angenehm kühl. Drei braune Chesterfield-Sessel stehen hier, auf einem liegt eine Hundeleine. Auf der Fensterbank ein riesiger Kübel mit blühenden Aturien, in einer Nische des Foyers zwei mannshohe Porzellanvasen mit Blumenmuster. Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe, kurz ZZF, hat das repräsentative Gebäude im Jahr 2007 gekauft, um das Geld anzulegen, das über Jahrzehnte durch die »Interzoo« in Nürnberg, die weltgrößte Messe der Heimtierbranche, in seine Kassen gespült worden war. Vorher residierte hier die hessische Architektenkammer.
Antje Schreiber, die junge, blonde Pressesprecherin des Verbandes, führt durch das Haus mit seinen stuckgeschmückten Wänden und geschmackvollen orientalischen Teppichen. Unter dem Dach waren früher die Stuben für das Gesinde, sie sind einen halben Meter niedriger als die Salons im Rest des Hauses, aber noch immer großzügig. Schreiber und eine Kollegin arbeiten hier für die Presseabteilung. In den vergangenen Wochen hat Antje Schreiber hier Daten sortiert, sie zu Säulendiagrammen geordnet und in Powerpointfolien verpackt. Es sind die Ergebnisse einer großen Studie zur Haustierhaltung in Deutschland, der wohl größten und am besten durchdachten bisher. Antje Schreiber erzählt, dass man jetzt zumindest eines relativ genau weiß: Wie viele Tiere heute wirklich in den deutschen Haushalten leben. Bis vor Kurzem waren noch nicht einmal diese Daten sicher. Immer wieder gab es zwar Studien, meist repräsentative Befragungen, bei denen ein Marktforschungsinstitut tausend oder etwas mehr Leute abtelefonierte und nach Haustieren, Konsumverhalten und noch ein paar Dingen fragte; das Ergebnis wurde dann hochgerechnet auf 80 Millionen Deutsche. »Aber in vielen dieser Studien wurde nur gefragt: Haben Sie Haustiere? Und, wenn ja: Mehr als eins? Die genaue Anzahl wusste man dann immer noch nicht«, sagt Schreiber. »Wir hatten bei bestimmten Zahlen immer große Fragezeichen. Gerade im Bereich der Aquaristik, Terraristik und der Kleinsäuger erschienen uns die Daten nicht plausibel. Wir wissen, dass Besitzer von Aquarien und Terrarien meist mehrere Tiere und auch mehrere Becken haben, weil es Bestandteil des Hobbys ist, Nachzucht zu produzieren.« Die bisherigen Zahlen waren im Hinblick darauf viel zu gering. Die Resultate der verschiedenen Studien widersprachen sich außerdem oft. Erst im Jahr 2012 überlegte man sich beim ZZF genau, wie eine repräsentative Datenlage beschafft werden könnte, und gab dann eine Studie in Auftrag, für die mehr als 2000 Haushalte telefonisch kontaktiert wurden. Man ging sehr viel exakter vor als bei früheren Untersuchungen: Zum Beispiel befragte man deutschsprachige Haushalte statt ausschließlich deutschstämmige – also Bürger mit deutschem Pass – wie viele Studien zuvor.
»Das Ergebnis ist auch noch nicht die letzte Wahrheit, aber eine Annäherung«, sagt Schreiber. 36 Prozent der Haushalte halten demnach mindestens ein Haustier. Das beliebteste Haustier ist mit 12,3 Millionen Tieren (in 16,5 Prozent aller Haushalte) die Katze, danach folgt mit 7,4 Millionen (in 13,4 Prozent aller Haushalte) der Hund. »Mit diesen Zahlen haben wir den Markt aufgemischt«, sagt Schreiber. Zuvor war man von wesentlich weniger Hunden und Katzen ausgegangen, zuletzt, im Jahr zuvor, hatte der Industrieverband Heimtierbedarf (IVH) 5,4 Mio Hunde und 8,2 Mio Katzen ermittelt. Schreiber schließt nicht aus, dass die neuen Daten noch Fehler enthalten. »Es kann sein, dass wir Haushalte, die züchten, falsch gewichtet haben. Die Antwort der Umfrageteilnehmer lautete etwa: Wir haben acht Katzen. Aber die Marktforscher haben nun nicht nachgefragt, ob gerade ein Wurf geboren worden war. Das wurde aber mit hochgerechnet und würde dann die Aussage verfälschen.« Deshalb soll jetzt noch einmal neu befragt werden; die Frage »Halten Sie die Tiere, um zu züchten?« wird dann auch gestellt werden.
Schon jetzt kann man allerdings die Zahlen der unterschiedlichen Tierarten in den Haushalten der Deutschen ungefähr beziffern:
- Auf Hund und Katze folgen die Kleinsäuger mit 7,6 Millionen Tieren, die in gut 6 Prozent der Haushalte leben, darunter vor allem Kaninchen, die etwa die Hälfte ausmachen, gefolgt von Meerschweinchen, Hamstern, Mäusen, Ratten, Chinchillas und Degus.
- Die Deutschen halten 3,7 Millionen Ziervögel – vor allem Wellensittiche, Kanarienvögel, Großpapageien und Finken –,
- haben 2,3 Millionen Aquarien, 2,6 Millionen Gartenteiche und 800.000 Terrarien.
In den Aquarien werden vor allem Süßwasser-Warmwasserfische und Süßwasser-Garnelen gehalten, selten Meerwasserfische. In den Gartenteichen schwimmen in erster Linie Goldfische, gefolgt von Koi-Karpfen. In den Terrarien sitzen vor allem Schildkröten, gefolgt von Eidechsen und Schlangen. Der Verband wollte mit seiner Untersuchung aber vor allem auch soziodemografische Daten über die Halter gewinnen. Es geht schließlich um die Einschätzung von Konsumenten und ihrer Marktkraft. Deshalb wurden die Halter unterschiedlicher Tiere nach Geschlecht, Alter, Einkommen und einigen anderen Kriterien sortiert. Halter von Katzen, Kleinsäugern und Ziervögeln sind demnach eher Frauen. Unter den Hundebesitzern halten sich Frauen und Männer ungefähr die Waage. Katzenhaltung ist in einer mittleren Altersgruppe zwischen 30 und 59 Jahren verbreiteter als bei den Jüngeren und Älteren. Hunde finden sich vorwiegend bei den noch Älteren, den über 40-Jährigen. Kaninchen und andere Kleinsäuger dagegen werden eher von Personen unter 50 gehalten, häufig leben diese Tieren in Familien mit Kindern. Ziervögel leben im Gegensatz dazu bei Singles, die meist Frauen sind. Aquarianer sind jünger als andere Gruppen und haben häufig Kinder. Terrarianer sind ebenfalls jung, meist unter 40; gleich viele Frauen wie Männer sind darunter. Ein hohes Nettoeinkommen findet sich vorwiegend – und logischerweise – bei einer ganz bestimmten Gruppe: den Gartenteichbesitzern. Trends lassen sich an einer solchen Momentaufnahme nicht ablesen. Aber der Industrieverband Heimtierbedarf hat schon zuvor über Jahre hinweg die Haustierpopulation und ihre Halter beobachtet.
- Steil nach unten, das belegen die Zahlen der IVH-Studien, geht die Tierhaltung vor allem bei den Dreißig- bis Vierzigjährigen, in der »Rush Hour« des Lebens also.
- Die Zahl der über 60-jährigen Tierhalter schoss im vergangenen Jahrzehnt dagegen steil nach oben.
- In den anderen Gruppen blieb die Zahl überwiegend stabil.
In der Heimtierbranche hofft man derzeit auf diese Rentnergeneration, die immer zahlreicher werdenden Alten. Dass sie häufiger Tiere halten als früher, hat wohl auch mit dem demografischen Wandel an sich zu tun: Ältere Menschen machen einfach einen größeren Anteil der Bevölkerung aus als früher.
Beim ZZF beobachtet man aber nicht nur die Demografie der Tierhalter. Mit besonders kritischem Blick wird die Zahl der Tiere registriert, die überhaupt gehalten werden. Sorgen bereitet beispielsweise das sinkende Interesse an der Ziervogelhaltung. Den Deutschen ist nicht mehr zu vermitteln, einen Käfig in der Wohnung zu haben.
»Der Käfig hat immer noch den Nimbus eines ›Knasts‹«
heißt es im Mai 2013 in einem Artikel im Zoologischen Zentral-Anzeiger, dem Mitteilungsblatt der Zoobranche. »Gitterstäbe erzeugen beim Verbraucher negative Emotionen.« Und selbst große Volieren machten den Haltern ein schlechtes Gewissen. Die Vogelhaltung entspricht einfach nicht mehr dem Zeitgeschmack. Beim ZZF spekuliert man, ob Bedenken durch Beratung ausgeräumt werden können, man hat auch Studien gefunden, die zeigen, dass Menschen blaue Vögel lieber mögen als grüne, große lieber als kleine. Den Zoohändlern wird empfohlen, diese Erkenntnisse zu nutzen, wenn sie Vögel in ihren Geschäften präsentieren. Doch der Abstieg der Vögel scheint nicht mehr aufzuhalten. Er findet sich in allen westlichen Industrieländern. In den Vereinigten Staaten ist die Zahl der Haushalte, die Ziervögel halten, in den vergangenen zwanzig Jahren um fast 50 Prozent gesunken. 4,5 Millionen Haushalte hielten 2006 noch einen Vogel. Bis 2011 ging diese Zahl auf 3,7 Millionen zurück.
Die Zahl der meisten anderen Tierarten, die in Deutschland gehalten werden, stagniert seit Jahren. Die neue Studie des ZZF hat diesen Eindruck verwischt. Mit früheren Erhebungen ist sie aufgrund der neu gewählten Befragungsmethode nicht vergleichbar. Trotzdem haben Journalisten die neuen Zahlen als plötzlichen Anstieg interpretiert. Die Zahl der Hunde sei in den letzten 12 Jahren von 5 auf mehr als 7 Millionen gestiegen, staunte die Bildzeitung und befragte dazu den Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann, der missbilligend sagte:
»Tiere sind den Deutschen inzwischen wichtiger als Kinder. Das macht mir Sorgen.«
In Wirklichkeit werde die Zahl der Tiere in den kommenden Jahren wohl kaum wachsen, wagt Detlev Nolte vom Industrieverband Heimtierbedarf eine Prognose. »Die demografische Entwicklung lässt das nicht zu. Aber die Beziehung zwischen Menschen und Tieren wird sich intensivieren.«
Marktforscher und Wissenschaftler haben immer wieder Zahlen geliefert, die diese Entwicklung schon jetzt belegen. Drei Viertel der Deutschen Haustierbesitzer lassen ihre Katzen und Hunde auf die Couch, hat beispielsweise eine Studie im Auftrag einer Tierhaarfusselroller-Marke erbracht. Fast jede zweite Katze und ein Drittel der Hunde darf nachts mit ins Bett. Die Zahl der Tierbestattungen in Deutschland hat sich seit 2010 um rund 74 Prozent auf jährlich etwa 160.000 erhöht. 14 Prozent der Hundehalter telefonieren aus dem Urlaub mit dem Hund, sechs Prozent schreiben eine Postkarte, fünf Prozent skypen mit ihm. Fast zwei Drittel der deutschen Hundehalter, 60 Prozent der Katzenhalter sowie mehr als die Hälfte der Aquarienbesitzer und der Halter von kleinen Heimtieren wie Hamstern und Kaninchen schenken ihren Tieren etwas zu Weihnachten.
Es gibt Trends über die nackten Prozentzahlen hinaus. Diese Trends haben etwas damit zu tun, wie sich die Gesellschaft insgesamt verändert.
An einem Wintertag in Berlin lassen Trendforscher einen Blick in ihre Welt zu. Sie sind sicher, dass Menschen von einem Leben mit Haustieren heute vor allem eines erwarten: Tiere sollen ihnen helfen, mit Stress, Einsamkeit und den Ansprüchen der Leistungsgesellschaft besser umgehen zu können.
Neugierig geworden?
„Das Tier und wir – Einblicke in eine komplexe Freundschaft“, erschienen im Blessing Verlag 2014, kann unter anderem bei Random House direkt bestellt werden.
Anmerkung: *Die Namen der in diesem Kapitel porträtierten Tierhalter sind verändert und einige persönliche Angaben sind verfremdet worden.
Bild & Quelle: Blessing Verlag, Random House, via Elisabeth Bayer