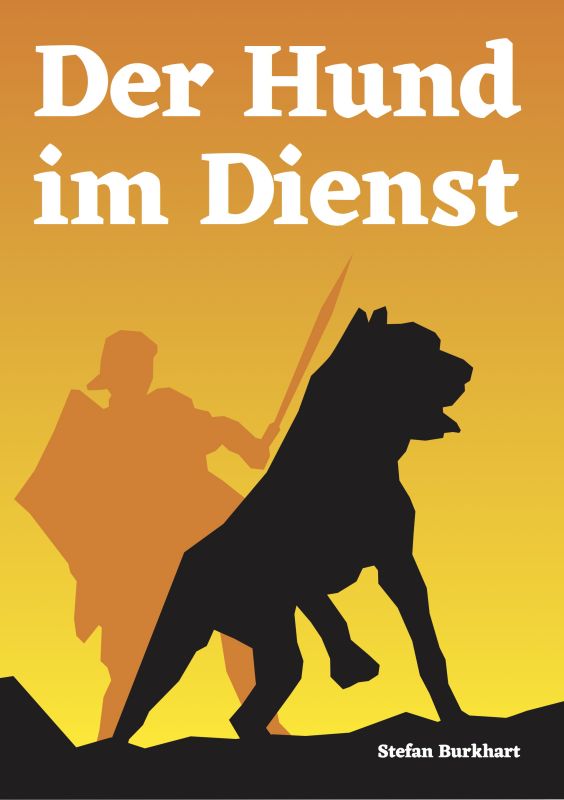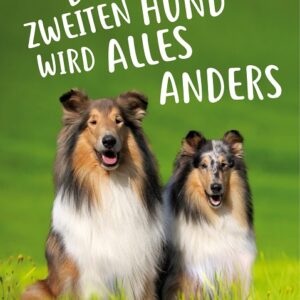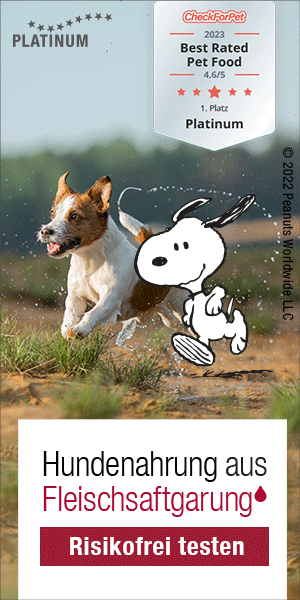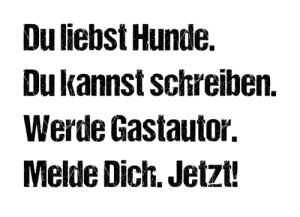Schon seit langer Zeit begleitet der Hund die Menschen im Krieg. Im Buch »Der Hund im Dienst« sind viele Episoden von rührender hündischer Treue, aber auch extremen Kampfeinsätzen zu finden. Wir haben einen Blick hineingeworfen und geben euch eine kleine Leseprobe.
War die Domestizierung des Wolfs Taktik?
Der Mensch ist die Krone der Schöpfung, sagt er selbst. Der Krieg ist der Vater aller Dinge, sagt Heraklit. Und der Hund ist des Menschen bester Freund, wissen wir alle. Die Domestizierung des Hundes setzte tief in prähistorischer Zeit ein. Doch wieso wollte der Mensch den Hund an seiner Seite haben? Viele Thesen zirkulieren. Könnte es sein, dass es im weitesten Sinne mit seinem militärischen Nutzen zu tun hat? Der Wolf verfügt über sensationelle Sinnesorgane. Hatte die Sippe in tiefer Vorzeit Wölfe um sich, so mussten sie nur deren Verhalten beobachten und erkannte frühzeitig, ob andere Wildtiere in der Nähe waren, die eine tödliche Gefahr darstellten könnten. Noch heute weiß jeder Hundefreund: Am Verhalten seines Zöglings kann man zuverlässig ablesen, ob er in der Distanz etwas erspäht hat, das den eigenen und sehr mäßigen Sinnesorganen entgeht. So begannen also die Menschen, die Wölfe zu füttern, um sie an sich zu binden. Aus dem so domestizierten Wolf wurde unser guter Hund.
Hunde haben bessere Sinne als der Mensch
Das ist doch nur eine Hypothese, werden manche einwenden… durchaus, aber: Moderne Kriege spielen sich oft auf tiefer Intensitätsstufe ab (z.B. Irak, Afghanistan, Palästina u.a.). Genau in diesem Umfeld wissen moderne Truppen die alten hündischen Gaben mehr denn je zu schätzen. Ein bisschen ironisch ist es gewiss, wenn ein mit Hightech-Gerät ausgestatteter Soldat ausgerechnet einen Hund in den Kampf führt, diesen anarchischen Begleiter seit Jahrtausenden. Jedoch macht es schlicht Sinn. Und das Prinzip ist immer noch dasselbe wie in tiefster Vorzeit: Hunde begleiten Menschen mit schwachen Sinnen und zeigen ihnen an, ob sich in den Trümmern, in einem Bunker, in einem Graben, in einer Garage, hinter einem Fahrzeug ein Feind versteckt. Intuitiv haben das Soldaten schon immer zu nutzen gewusst. Im 1. Weltkrieg gab es sogenannte Postenhunde, die man auf exponierte Stellungen mitnahm und die gerade nachts das Annähern eines feindlichen Kommandos anzeigen konnten. Das beruhigte die Männer und half ihnen, einen Überraschungsangriff zu überleben.
Die Geschichte von „Treu“
Äußerst nützlich erwiesen sich die Sinnesorgane eines Hundes namens Treu. Sein Herr war der leidig bekannte Schriftsteller Maximilian Böttcher, der als Offizier an der Westfront diente. Treu begleitete ihn überall hin und war auch auf einem Kommandounternehmen dabei. Es galt, bei Nacht eine Brücke hinter den französischen Linien zu sprengen. Als sich der Trupp durch das sumpfige Gelände quälte, blieb Treu plötzlich stur stehen und zitterte. Er hatte etwas erkannt. Tatsächlich erspähten die Männer in rund 100 Meter Entfernung die Umrisse zweier französischer Soldaten. Ein Vizewachtmeister wollte schon schießen, doch Böttcher fiel ihm in den Arm. Auf keinen Fall! So hätte man die Aufmerksamkeit (und das Feuer) des ganzen Abschnitts auf sich gezogen. Stattdessen erledigte der Mann unter Mithilfe des Hundes die beiden Feinde. Wie der Vizewachtmeister meinte, gebühre „Treu“ das Eiserne Kreuz.
Erstaunlich bei Treus Geschichte: Der Hund hatte keine spezielle Ausbildung. Sein Halter hatte ihn einst von einem gefallenen englischen Major übernommen. Man sieht daran, dass es die natürlichen Gaben des Hundes sind, die man in militärischen Nutzen ummünzen kann. Mit entsprechendem Training geht natürlich noch viel mehr und so brachte man den Hunden bei, nicht nur Feinde anzuzeigen, sondern auch Sprengstoff. Im zweiten Weltkrieg halfen Hunde beim Räumen von Minenfeldern. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die Technik verfeinert, so dass heute Hunde in vielen Konfliktgebieten im Einsatz stehen und vor Sprengstoffen warnen.
Hunde der spanischen Eroberer
Berüchtigt für ihre Kampfkraft waren auch die Hunde der spanischen Eroberer in Süd- und Zentralamerika, die Perros Bravos. Ihr militärischer Nutzen war bescheiden, wenngleich es einige reißerische Berichte gibt. Die Indianerheere waren zwar rüstungstechnisch unterlegen, aber bestimmt auf einem Niveau, um einer Hundeattacke gewachsen gewesen zu sein. Die spanischen Kampfhunde dienten eher dazu, die indianische Bevölkerung zu terrorisieren.
Der berühmteste dieser Kampfhunde war Becerillo. Er gehörte Jean Ponce de León, einem Konquistador, der zeitweilig Gouverneur auf Puerto Rico war. Dort kam es zu einem Indianeraufstand. Salazar, ein spanischer Kommandeur unter Ponce de León, wurde in der Nacht mit seinen Männern angegriffen. Glücklicherweise hatten sie Becerillo dabei. Die Spanier schliefen, als sich die Feinde anschlichen. Doch Becerillo bellte wie wild. Salazar sprang auf, ergriff sein Schwert und stürzte sich – ansonsten noch unbekleidet – mit seinen Männern in den Kampf. Nach einer Stunde waren die Angreifer unter Beihilfe des Hundes niedergerungen.
Man darf solche Schilderungen zwar nicht wörtlich nehmen, sie geben aber eine Idee vom Kampfwert eines aufmerksamen und energischen Hundes vom Schlage eines Becerillo. Umso mehr überrascht die wohl berühmteste Anekdote über ihn: Besagter Salazar führte eines nachts ein Gefecht mit aufständischen Indianern. Am Morgen saßen seine Kämpfer bei einem Dorf herum. Sie langweilten sich und riefen eine alte Indianerfrau herbei, der sie einen Zettel mit einer Nachricht gaben, die sie zum Gouverneur tragen sollte. Die Frau lief los, während die Männer Becerillo von der Leine ließen. Er rannte der Frau hinterher und die Rohlinge waren gespannt, was passieren würde. Sie trauten ihren Augen nicht. Plötzlich blieb Becerillo stehen. Die Frau ging auf die Knie und sagte zum Hund: Tue mir nichts, ich trage diese Nachricht zu Christenmenschen. Darauf wandte sich Becerillo ab und hob nur sein Bein, um zu urinieren. Kurz darauf traf sein Besitzer, Ponce de León ein, der sich ein Bild von der Lage machen wollte. Die Männer erzählten ihm die Geschichte. Daraufhin ließ er die Frau frei.
Der Hund als mentaler Stabilisator
Vor allem sind alle Hunde eines: treu. Tatsächlich waren Hunde im Krieg immer ein emotionaler Faktor und für viele Soldaten ein mentaler Stabilisator in der Extremsituation des Krieges. Legendär ist in dieser Hinsicht eine Lithographie des französischen Künstlers Nicolas-Toussaint Charlet von 1837. Sie zeigt einen jungen Soldaten am Boden sitzend, der einen Hund streichelt. Sein Gewehr liegt am Boden. Darunter steht: A bien dire, ce qu’il y de meilleur dans l’homme c’est le chien. Frei ins Deutsche übersetzt: Das Beste an den Menschen sind die Hunde.
Die Geschichte des Krieges ist prall gefüllt mit Episoden von Hunden, die den Soldaten ins Feld folgten, einfach so, ohne dass sie offiziell Militärhunde gewesen wären, einfach weil sie die Menschen liebten und umgekehrt. Oft waren es Streuner, von denen es in jedem Krieg besonders viele gibt, die sich einem Zug oder einer Kompanie anschlossen.
Kaum zu übertreffen in Sachen hündischer Treue war Tofino, ein Barbet. Er war mit seinem Halter in Mailand stationiert, wo er es sich im Schilderhaus gemütlich machte. Passierte ein Offizier, so stellte sich Toffino auf die Hinterpfoten und führte seine rechte Vorderpfote zum Kopf hin, wodurch sich das Bild eines militärisch korrekten Grußes ergab. Zusammen mit seinem Regiment nahm Tofino 1812 am Russlandfeldzug Napoleons teil. Er lief bis Moskau. Er sah, wie die Stadt abbrannte. Er sah, wie die Grande Armée auf ihrem Rückzug dahinschmolz. Er schwamm auf der Flucht vor den nachstoßenden Russen über die eiskalte Beresina. Tofino wartete auf der anderen Flussseite. Doch sein geliebter Meister kam nie an. Andere Soldaten trösteten ihn, aber er aß keinen Bissen. Schließlich raffte er sich auf, schloss sich anderen Einheiten an, marschierte durch Litauen, Polen, Preußen, Sachsen, über die Alpen, bis er wieder in Mailand war, wo er sich schnurstracks zur Kaserne begab. Er wurde von den dortigen Soldaten adoptiert und in der ganzen Stadt bekannt. Eugène de Beauharnais (Vizekönig von Italien) ordnete an, ihn als Kostgänger des Staates zu betrachten. Jeden Morgen und Abend brachte ihm ein Soldat einen Topf mit Futter.
Autor: Stefan Burkhart
In aller Ausführlichkeit und viele andere Geschichten findest du im Buch „Der Hund im Dienst“ von Stefan Burkhart (ISBN 978-3756244584). Es werden weitere Funktionen beschrieben wie Sanitätshunde, Nachrichtenhunde, Wachhunde, Blindenhunde, Schlittenhunde u.a. Die Schilderungen beginnen in den Tiefen der Vorzeit und enden im 1. Weltkrieg.